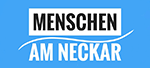Anfang und Ende der Atomenergie vom Neckar
Am 15. April 2023 endet mit der Abschaltung des Atomkraftwerks Neckarwestheim II das Zeitalter der Atomenergie in Baden-Württemberg. Der Neckar beherbergte drei der insgesamt fünf kommerziellen Kernkraftwerke in Baden-Württemberg, das lange „Atommusterländle“ gewesen war.
Mit dem Mehrzweckforschungsreaktor in Karlsruhe ging 1966 zwar der erste Reaktor am Rhein ans Netz. Dieser speiste allerdings im Vergleich mit späteren Reaktoren nur wenig Energie ein und diente hauptsächlich zu Forschungszecken. Der Beginn des kommerziellen Atomzeitalters im Land markierte die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks (AKW) Obrigheim am Neckar im April 1969.
„Musterländle“ der Atomenergie
Schnell entwickelte sich Baden-Württemberg zum „Musterländle“ der Atomenergie. Es kamen die Kernkraftwerke in Neckarwestheim I (1976) und Philippsburg I (1980) hinzu, gefolgt von den AKW Philippsburg II (1985) und Neckarwestheim II (1989).
1974 hatte die Kernenergie noch „nur“ 11 Prozent Anteil an der in Baden-Württemberg erzeugten Strommenge. 1994 erreichte der Atomstrom das Maximum mit 61 Prozent. Den Hauptanteil daran hatten die von der EnBW betriebenen Reaktoren der AKW Philippsburg II und Neckarwestheim II, die mit 11 bis 12 Terrawattstunden im Jahr zu den leistungsfähigsten der Republik zählten. Im 21. Jahrhundert reduzierte sich der Anteil der atomar erzeugten Energie immer weiter durch den ersten und zweiten Ausstieg aus der Atomenergie und die vermehrte Einspeisung von anderen Energiequellen wie Erneuerbaren. Von den insgesamt drei Forschungsreaktoren in Karlsruhe wurde der letzte bereits 1991 stillgelegt.

Menschen am Neckar und die Kernkraft
2022 waren noch rund 700 Angestellte im AKW Neckarwestheim II für den Betrieb des letzten verbliebenen Kernkraftwerks verantwortlich. Damit dürften in der Spitze mehrere Tausend Baden-Württemberger*innen in der Atomenergiebranche beschäftigt gewesen sein. Auch an Baden-Württembergs Hochschulen insbesondere Karlsruhe und Heidelberg aber auch in Stuttgart und Freiburg wurde und wird intensiv zu Atomphysik geforscht und gelehrt.
Der Fortschrittsglaube in den 1950er- und 60-Jahren war groß und die Einstellung der Bevölkerung zur Atomkraft in der Bundesrepublik zunächst sehr positiv. Selbst nach der Etablierung einer Anti-AKW-Bewegung zählten sich 1984 nur 23 Prozent der Bevölkerung zu moderaten und entschiedenen Gegnern der Kernenergie. Erst der größte anzunehmende Unfall (GAU) von Tschernobyl 1986 sorgte für einen schnellen Anstieg der Gegnerschaft auf 41 Prozent in der Bevölkerung. Nach diesem Schock ging die Angst vor einem Unglück wieder zurück. Erst mit der Katastrophe von Fukushima 2011 lehnten 62 Prozent der Bevölkerung der alten Bundesländer und 56 Prozent der neuen Bundesländer den Einsatz von Kernenergie ab. Doch gerade in Baden-Württemberg genießt die Kernenergie größeren Rückhalt als anderswo. Angesichts der aktuellen Energiepreiskrise können sich 57 Prozent der Menschen im Land einen Wiedereinstieg vorstellen.

Allerdings gilt der erfolgreiche Widerstand von Bauern, Winzern und vielen Bürgerinitiativen gegen die Errichtung des Kernkraftwerks in Breisach bzw. Wyhl am Kaiserstuhl als Keimzelle der Anti-Atomkraftbewegung in der Bundesrepublik. Das harte Durchgreifen der Polizei gegen gewaltlose Demonstranten brachte der Bewegung viel Sympathie und regen Zulauf ein. 28.000 Menschen besetzen die Baustelle 1975. Vorausgegangen waren Aktionen gegen den Bau des französischen Reaktors im nahe gelegenen Fessenheim, was als erste große Protestaktion gegen die zivile Nutzung der Kernenergie in Europa gilt.
Atomsicherheit im Land
Dass trotz erfolgreichen Aktionen der Anti-AKW-Bewegung das Lager der Atomkraftbefürworter groß blieb, mag auch daran gelegen haben, dass es an Rhein und Neckar zu keinem großen Störfall im internationalen Vergleich gekommen ist. Dennoch gab es auch beim Betrieb der Kraftwerke im Land ernste Störungen und Störfälle. Im Juli 2004 trat in Neckarwestheim aufgrund menschlichen Versagens mit 2 Megabecquerel kontaminiertes Wasser in den Neckar aus. Besonders das AKW Obrigheim galt Umweltorganisationen als besonders unsicher, da es jahrelang ohne entsprechende Dauergenehmigung betrieben wurde und als veraltet galt. Insgesamt gab es zu 1531 sogenannten „meldepflichtigen Ereignisse“ im Land – also einem Ereignis alle 13 Tage.
Was bleibt
Bis auf Neckarwestheim II befinden sich alle anderen Kernkraftanlagen des Landes bereits im Rückbau. Der verstrahlte Atommüll aus Brennstoffen und rückgebauten Anlageteilen verbleibt bis zur Findung eines Endlagers in Zwischenlagern in Baden-Württemberg und wird damit noch einige Jahrzehnte hier verbleiben. Ein Endlager in Baden-Württemberg ist unterdessen nicht ausgeschlossen. Die Schweiz hat unlängst angekündigt ihren Atommüll an der Grenze zu Baden-Württemberg einlagern zu wollen.
Das AKW Obrigheim ist schon seit 2005 abgeschaltet und soll bis Mitte der 2020er-Jahre vollständig abgebaut sein. Teile der Anlage sind über den Neckar ins Zwischenlager Neckarwestheim transportiert worden.
Auch wenn in Baden-Württemberg keine Energie mehr aus der Kernspaltung gewonnen wird, sind die verstrahlten Abfälle aus der rückgebauten Kraftwerke eine Herausforderung für nächste Generationen. Zudem sind nicht alle europäischen Nachbarn vom Ausstieg überzeugt. Die Schweiz betreibt noch AKW an der Grenze zu Baden-Württemberg und Frankreich setzt voll auf Atomstrom. Bei dem gesamteuropäischen Stromnetz wird deshalb auch weiter noch Nuklearenergie aus baden-württembergischen Steckdosen gezapft werden.

Zum Weiterlesen:
John, Birgit: Nutzung der Kernkraft in Baden-Württemberg, in: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Hg.): Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 4/2011, Online.
Privat Radio Baden-Württemberg (Hg.): Baden-Württemberg Report März 2023. So tickt Baden-Württemberg, S. 22, Online.
Eith, Ulrich: Wyhl – „Nai hämmer gsait!“ – stilbildender ziviler Widerstand am Kaiserstuhl. Erinnerungsorte in Baden-Württemberg, in: Reinhold Weber, Peter Steinbach und Hans-Georg Wehling (Hg.): Baden-württembergische Erinnerungsorte, Stuttgart 2012, Online.
Radkau, Joachim: Eine kurze Geschichte der deutschen Antiatomkraftbewegung, in: Ende des Atomzeitalters? Aus Politik und Zeitgeschichte APuZ 46-47/2011, Online.
Institut für Demoskopie Allensbach (Hg.): Atemberaubende Wende. Eine Dokumentation des Beitrags von Prof. Dr. Renate Köcher in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Nr. 93 vom 20. April 2011, Online.